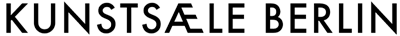IM MOMENT DER BILDBETRACHTUNG WIRD DER INNERE MONOLOG GESTOPPT
BILDER AUS DER SAMMLUNG BERGMEIER UND DER SAMMLUNG OEHMEN.
kuratiert von Julian Malte Schindele
Michael Müller, Jenny Michel, Peter Nagel, Norbert Tadeusz, Ulf Puder, Konrad Klapheck, Ben Willikens, Dieter Krieg, Arno Bojak, Matthias Reinhold, Ludwig Vandervelde, Stefan à Wengen, Rosemarie Trockel
27.04.2012 - 16.06.2012
„Im Moment der Bildbetrachtung wird der innere Monolog gestoppt“; - die Ausstellung ist eine über die Außenwelt und mögliche Formen mit ihr in Beziehung, in Dialog zu treten.
Für mich ist sie zudem, nicht als Erstes und nicht als Letztes, auch ein Manifest des beständigen Scheiterns. Die menschliche Existenz konstituiert sich in der Erfahrung der Außenwelt und kann diese jedoch nie vollkommen einholen.
Die Ausstellung möchte ein wenig zur Verzauberung der Welt beitragen, dies versucht sie indem sie die Grenzen unserer Wahrnehmung des Objekts auslotet und im allerbesten Fall ein wenig verschiebt.
Das Großteil der Arbeiten, die ich für diese Ausstellung aus der Sammlung Bergmeier und der Sammlung Oehmen auswählen durfte, sind zeichnerische und malerische Annährungen an Objekte. Nur wenige Arbeiten, unter ihnen die im Foyer hängenden Labyrinthe und die eine Arbeit vom alten Dieter Krieg, von der ich mir nach Bestärkung einer Freundin den Titel geliehen habe, fallen aus diesem Kanon unmittelbar heraus.
Die Schau, so lässt sich sagen, fragt nach den möglichen Bedeutungen und Ausprägungen des Dialogs. Ein Dialog ist immer ein hin-und-her. Ein Nehmen und Geben. Auch hat er, so zu mindest in meinem Verständnis, eine recht ausgewogene Struktur. Sprich er ist schwerlich hierachisch. Kriegs titelgebender Aphorismus hat mich (ver)leitend zu diesem Thema gebracht. Ohne an dieser Stelle zu viel darüber nachdenken zu wollen, dass wir es in der Bildbetrachtung bei dieser Arbeit eigentlich mit einem Text (und in wiefern dieser Bild ist, sobald er auf die Leinwand gebannt ist etc.) zu tun haben, möchte ich auf den Monolog weisen. In der Anschaung, ob formulierend im Denken oder wirkend im Sehen, wird der Monolog zum Dialog. Dies wird insbesondere in der Betrachtung von Kunstwerken (die wir in unserem heutigen Verständnis für sehr selbstständige Wesenhaftigkeiten halten) flagrant, gilt jedoch allgemein für jedes Objekt. Die für diese Ausstellung ausgewählten Werke zeigen daher primär Objekte. Objekte so gesehen, gefühlt und erlebt von verschiedenen Künstlern und in der ihnen eigenen Sprache wiedergegeben. Diese kann sich bspw. psychologisch aufgeladen/aufladend, überhöhend, abstrahierend oder auch als reine Konstruktionszeichnungen, die uns in das Innenleben der Maschinen führt, äußern. Das Objekt an sich ist nicht zu erreichen, aber mittel- und erfahrbar durch die Geste und Arbeit des Künstlers; - als ob wir durch ein Fenster schauen würden, dass uns Alltägliches zeigt, aber wir stehen außerhalb und staunen.
Die von mir ausgewählten Deskriptionen von Sachverhalten und Gegenständen, die allesamt aus dem Brockhaus, der für sich selber in Anspruch nimmt ‚das gesicherte Wissen der Welt‘ und damit einen Objektivitätsanspruch zu repräsentieren, und der/das mir freundlicherweise äußerst kurzfristig zur Verfügung gestellt wurde, stammen, schlüsseln die Frage nach faktischen Beziehungen, aber auch inwiefern unser Denken stets vorgeprägt ist, auf. Die Sprache und unser Wissen um etwas, präzesieren unseren Blick, neigen aber auch dazu diesen zu beschränken. Nicht umsonst wandert der Blick des ‚Bildbetrachtes‘ oft ungewollt und triebhaft schnell zu den nebst angebrachten Objektschild.
Die diversen in der Ausstellung angebrachten Täfelchen, sind neben dem rein faktischen Wissen das auf ihnen nachzulesen ist, Verführung zu wildwüchsigen Assoziationen. Dieser spielerische Vorgang ist weder schlecht, noch gut und löblich, sondern führt uns vor, wie Anschauung häufig funktioniert. Stets im Gepräge der eigenen Kentnisse. (Selbst, wenn man Vlado Martek emphatisch beipflichtet: „Beruhige dich Schatz, die Poesie ist kein Wunder.“)
Vielleicht lassen sich einige der Besucher, trotz des Assoziativen-Quantums an geballten Fakten - oder gerade deswegen -, in die Posie einzelner Werke fallen. Die textuelle Ebene muss nicht ablenken, sondern kann den Blick in der Reflektion freier machen.
Die aufgeworfene Frage nach dem Monolog/Dialog ließe sich natürlich auch als Frage nach dem Innen/Außen, Subjekt/Objekt und in vielen vielen anderen (abendländischen und weniger abendländischen) Dichotomien formulieren. Letztlich lässt sich jedoch nur mit großer Sicherheit feststellen, dass der zweite Teil des Paares Ersteres bedingt (ob es umgekehrt ebenfalls so ist, möchte ich hier dahingestellt lassen und vermag es auch ehrlich gesagt nicht).
Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt?
Ich wünsche allen Besuchern viel Freude mit der Ausstellung.
Julian Malte Schindele
----